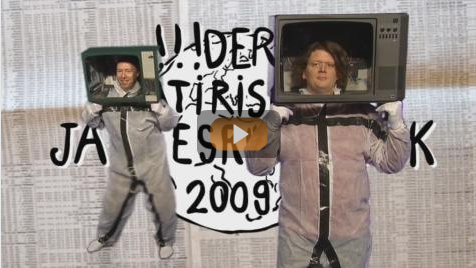Subversive Spielchen, die man in Bezug auf Konsum und Kommerz und Reklame treiben kann, gibt es ja so einige. Sehr hübsch finde ich beispielsweise die nachfolgende Idee, die Gaylord Fields in seinem Artikel „Buyer beware“ im Stay free! Magazine (und im Buch „Ad Nauseam“) schildert, und die jede und jeder im Supermarkt um die Ecke selbst ausprobieren kann.
Subversive Spielchen, die man in Bezug auf Konsum und Kommerz und Reklame treiben kann, gibt es ja so einige. Sehr hübsch finde ich beispielsweise die nachfolgende Idee, die Gaylord Fields in seinem Artikel „Buyer beware“ im Stay free! Magazine (und im Buch „Ad Nauseam“) schildert, und die jede und jeder im Supermarkt um die Ecke selbst ausprobieren kann.
—————
Käufer aufgepasst!
Wie reagieren Supermarktkunden, wenn man fremde Dinge in ihren Korb legt? Gaylord Fields probiert es aus.
Mehrere jüngst veröffentlichte Studien legen nahe, dass Supermärkte darauf ausgerichtet sind, den durchschnittlichen Käufer einzulullen und in einen tranceähnlichen Zustand zu versetzen, und dass diese „glasiger Blick“-Betäubung dazu führt, dass die Kunden mehr Sachen kaufen. Dies überrascht mich nicht, da diese Ergebnisse meinen eigenen Entdeckungen entsprechen, die ich vor dreißig Jahren machte, als ich unter dem Deckmantel jugendlicher Streiche einige Experimente in sozialer Psychologie unternahm.
Die Zeit: die frühen 1970er Jahre. Der Ort: ein typischer Upper West Side Manhattan-Supermarkt, welcher, für alle, die sich nicht mit New Yorks Geschäftsimmobilien auskennen, in etwa die gleiche Fläche einnahm wie die Obst- & Gemüse-Abteilung eines typischen amerikanischen Megamarkts heutiger Tage. Die Forscher: anfangs ein Trio gelangweilter 13jähriger, später zusammengeschrumpft auf einen werdenden Sozialwissenschaftler, sowie jede Menge anonymer Käufer und Kassierer, denen ich nachträglich meinen Dank schulde.
PHASE EINS
Während unserer anfänglichen Streifzüge in den Supermarkt der Gegend, prüften wir das Ausmaß an Kooperation unserer gastgebenden Anlaufstelle. Einfacher ausgedrückt, probierten meine Kollegen und ich, womit wir unter dem Argusauge eines konvexen Spiegels (wir reden von der Vor-Überwachungskamera-Zeit 1973) davon kommen würden. Dies bestand vor allem aus solchen Aktivitäten, sich die Taschen mit Marken-Schokoriegel vollzustopfen und Toilettenpapierrollen in Tiefkühltruhen zu packen. Wir zogen sehr wenig Aufmerksamkeit von den beschäftigten Kunden und vor allem von den Angestellten auf uns, und entwickelten in der Folgzeit die Kaltblütigkeit, Fingerfertigkeit und Heimlichkeit, die wir für einen erfolgreichen Abschluss unseres Einsatzes benötigten.
PHASE ZWEI
Für diesen Teil des Experiments war die Beteiligung meiner Kollegen nicht mehr vonnöten, da wir als Gruppe männlicher Teenager unnötige Aufmerksamkeit auf uns gezogen hätten. Dieser wissenschaftlich-orientierte junge Erwachsene musste den Weg alleine gehen. Denn an diesem Punkt begann das Experiment in seiner Ernsthaftigkeit, und ich werde meine Entdeckungen mit den später folgenden Studien, von denen ich im ersten Absatz sprach, verbinden.
Das Experiment war einfach aufgebaut: es beinhaltete das heimliche Platzieren verschiedener Supermarktwaren in den Einkaufskorb oder -wagen eines durch den Experimentator, sprich: mich, ausgesuchten Kunden (das „Subjekt“). Ich folgte dem Subjekt dann an eine Stelle direkt hinter ihm oder ihr in der Schlange an der Kasse und beobachtete, ob er oder sie den Kaufakt vollendete, indem er oder sie das eingeschmuggelte fremde Produkt (den „Gegenstand“) kaufte.
Weil wir Wissenschaftler auch nur Menschen sind, kann ich nun zugeben, dass ich das Protokoll etwas verletzte, indem ich im Vorfeld spekulierte, welche Resutate ich bekäme. Ich nahm an, dass, je weniger Produkte jemand in seinem Korb hätte, er den Gegenstand umso eher ablehnen würde. Ich nahm ebenfalls eine einfache Korrelation zwischen der Ungewöhnlichkeit eines Gegenstands und seiner Ablehnung an. Deshalb war mein anfänglicher Gedanke, es auf die sichere Tour zu spielen, indem ich bekannte Marken in einen vollgeladenen Wagen legte. Ich vermutete, dass ich durch einen gewissen Grad an Erfolg (den Kauf des Gegenstands durch das Subjekt) mit der Zeit das Risiko des Entdecktwerdens würde erhöhen können, ungewöhnlichere Dinge, z.B. eine Packung Airwick-Luft-Bestäuber oder Knorr Hühnerbouillon-Würfel könnten in einen Korb hineingelgt werden, der bloß vier oder fünf Sachen enthielte.
SCHLUSSFOLGERUNG
Innerhalb eines Jahres der Versuche, durchschnittlich zwei Mal pro Woche durchgeführt, lehnte nicht ein einziges Subjekt den Gegenstand ab oder schaute ihn auch nur befremdet an; alle Gegenstände wurde ohne weitere Frage gekauft. Es spielte keinerlei Rolle, ob es ein unglaublich gewöhnlicher und allgegenwärtiger Gegenstand war, so wie eine Rolle Scott Küchentücher, oder ein eher ausgefallenes Produkt wie ein Fleischthermometer. Vierzig Gegenstände oder vier, die Einhaltungsrate lag bei erstaunlichen 100 Prozent! Jeder kaufte, was ihm in den Korb gelegt wurde, ohne eine Sekunde zu zögern.
Leider wurde mein jugendlicher Aufstieg in die Sozialwissenschaften durch eine Reihe von Faktoren gebremst, vor allem die überwältigend einseitigen Daten, die ich gesammelt hatte, die Ablenkungen eines zunehmend herausfordernden High-School-Studienplans und mein Bewusstwerden der Tatsache, dass ich einen quiekenden Hund mitsamt seinem Wurf nuckelnder Welpen in den Wagen einer Person hätte legen können, ohne dass dieser es bemerkt hätte. Aber vor allem war es das Wissen, dass, falls meine Experimente durch diejenigen entdeckt werden würden, die es ablehnen könnten, die Bedeutung meiner Mission zu verstehen, ich den Schutz meines jugendlichen Status verlöre, sobald ich das Alter von 18 Jahren erreichte. Ich warte nun auf Phase drei meines Experiments, die irgendwann nach dem Jahr 2030 stattfinden wird, wenn die vermutete Senilität des Autoren der Deckmantel sein wird, unter dem ich meine Studien wieder aufnehme, und dann wird es eine noch breitere Palette an Dingen geben, die ich einer ganz neuen Generation von Käufern aufdrücken könnte.
————-
Als Variation dieses schönen „Experiments“ bietet es sich vielleicht an, besonders schreckliche Dinge (Nestlé-, Milka- oder Coca-Cola-Dreck beispielsweise) aus einem Einkaufswagen zu entfernen und z.B. durch Biowaren zu ersetzen (oder halt ganz wegzulassen). Mal schauen, ob das jemand bemerkt. :)

Verwandte Beiträge: