 Nach all den Büchern, die sich mit den mehr praktischen Aspekten des Culture Jamming und der Konsumkritik beschäftigen, stieß ich vor einigen Wochen zu meiner Freude auf ein theoretisch ausgerichtetes Werk, das diese Widerstandsform und die kritische Auseinandersetzung mit dem Konsumkapitalismus (so nennt der Autor unser System konsequent im gesamten Buch) von (kommuniktions)wissenschaftlicher Seite her beleuchtet. Andreas Völlingers „Im Zeichen des Marktes. Culture Jamming, Kommunikationsguerilla und subkultureller Protest gegen die Logo-Welt der Konsumgesellschaft“ gelingt es dabei, die Grundlagen des sog. „semiotischen Widerstands“ gegen die herrschende Logo- und Zeichenflut, die uns durch die Kozerne via Marketing, Werbung und Medien aufgezwungen wird, gekonnt darzulegen als auch über verschiedene Formen subkulturellen Widerstands (wie Skateboarding, Graffitti und Adbusting) zu referieren.
Nach all den Büchern, die sich mit den mehr praktischen Aspekten des Culture Jamming und der Konsumkritik beschäftigen, stieß ich vor einigen Wochen zu meiner Freude auf ein theoretisch ausgerichtetes Werk, das diese Widerstandsform und die kritische Auseinandersetzung mit dem Konsumkapitalismus (so nennt der Autor unser System konsequent im gesamten Buch) von (kommuniktions)wissenschaftlicher Seite her beleuchtet. Andreas Völlingers „Im Zeichen des Marktes. Culture Jamming, Kommunikationsguerilla und subkultureller Protest gegen die Logo-Welt der Konsumgesellschaft“ gelingt es dabei, die Grundlagen des sog. „semiotischen Widerstands“ gegen die herrschende Logo- und Zeichenflut, die uns durch die Kozerne via Marketing, Werbung und Medien aufgezwungen wird, gekonnt darzulegen als auch über verschiedene Formen subkulturellen Widerstands (wie Skateboarding, Graffitti und Adbusting) zu referieren.
Auch wer sich schon intensiv mit der gesamten Thematik befasst und z.B. die Bücher von Kalle Lasn oder Naomi Klein gelesen hat, wird hier noch einiges Neues entdecken, zumal der Reiz dieser Untersuchung des Autors sicherlich darin liegt, dass er einen weiten Bogen von postmodernen / poststrukturalistischen Theorien von Eco, Debord, Barthes oder Bourdieu, wie sie manch Studenten in der Uni begegnen, hin zu den praktischen und konkreten Aspekten (The Yes Men, Subvertising) schlägt. Dies geschieht alles auch mit einer eindeutigen Sympathie für die Absichten von Culture Jammern und anderen Gruppen, die sich gegen die Durchkommerzialisierung des Alltags stemmen (wie vor allem im persönlich geprägten Ausblick am Ende des Buches deutlich wird). Auf knapp 150 Seiten wird ein umfassender und dennoch recht kompakter Überblick gegeben, wie breit die Ideen des „zeichenhaften Widerstands“ in der Gesellschaft bereits gestreut sind und in welch unterschiedlichen Ausprägungen sie vorkommen können und wo die Grenzen und Risiken liegen. Der Autor zeigt auch, wie weit Konzerne mit ihren Symbolen und Logos in unserem Alltag hereinreichen und dass öffentliche Räume (und damit das gesellschaftliche Miteinander) immer stärker gefährdet sind, zu reinen Konsumräumen zu werden.
Die wissenschaftlich gehaltene Sprache und die vielen Literaturangaben und Querverweise mögen dabei vielleicht den einen oder anderen Aktivisten erst einmal abschrecken – sollten sie aber nicht! Eine wahre Fundgrube stellt nämlich die umfangreiche Literaturliste im Anhang dar, die auch für mich noch viele bis dato unbekannte Internet-Quellen und auch Leseanregungen bereit hält – davon werden alle Leser meines Blogs in der Zukunft sicher noch profitieren. :-)
Mein Fazit: ein spannendes Buch, das eher für Fortgeschrittene gedacht ist bzw. für Menschen, die sich Themen lieber wissenschaftlich-theoretisch nähern. Von daher ist Völlingers Werk natürlich kein Ersatz für „Aufrüttler“ wie Lasns „Culture Jamming“ oder „Das Schwarzbuch Markenfirmen“, sondern eine gute ergänzende Lektüre, die einige neue Facetten der Bewegung aufzeigt und Culture Jamming und Adbusting auch im wissenschaftlichen Diskurs verstärkt ankommen lässt. Ein Angriff auf die Deutungshoheit der Zeichen, die bisher bei den Konzernen und ihren Medien liegt, muss meiner Meinung nach sowieso von den verschiedensten Seiten aus erfolgen, wenn eine Schwächung Aussicht auf Erfolg haben soll, um ein kritischeres Bewusstsein bei den Menschen für die sie umgebenden Botschaften zu wecken und zu schärfen.
Während die Mitglieder einer subkulturellen Gemeinschaft durch semiotischen WIderstand hauptsächlich Abgrenzung betreiben, kann Culture Jamming als Mittel der Kontaktaufnahme dienen, um gerade dort anzusetzen, wo herkömmliche Argumentation gegen das herrschende System versagt:
„Wo Aufklärung nicht ankommt, kann Kommunikationsguerilla die wirksamere Taktik sein, wo es eine aufnahmebereite Zielgruppe oder gesellschaftlichen Druck gibt, ist Aufklärung und Information angesagt, und oft greifen beide ineinander.“ (autonoma a.f.r.i.k.a. gruppe)
Aus dieser Warte bietet Culture Jamming eine Möglichkeit, Gesellschaftskritik auch zu jenen Menschen zu tragen, die sich dieser verweigern – Debord würde hier wohl argumentieren, dass sie der vom konsumkapitalistischen Spektakel erzeugten Passivität erlegen sind – und möglicherweise auch bei ihnen einen Denk- und vielleicht sogar Umdenkprozess anzuregen.
Dieser Aus- und Ansicht des Autors schließe ich mich gerne an.
Andreas Völlinger „Im Zeichen des Marktes. Culture Jamming, Kommunikationsguerilla und subkultureller Protest gegen die Logo-Welt der Konsumgesellschaft“, Tectum Verlag 2010, 148 S., 24.90 €
Verwandte Beiträge:
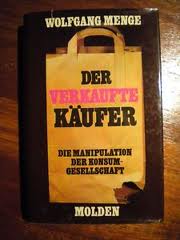 Der verkaufte Käufer. Die Manipulation der Konsumgesellschaft.
Der verkaufte Käufer. Die Manipulation der Konsumgesellschaft.




 In den letzten Tagen bin ich beim Herumstöbern im Netz auf drei sehr lesenswerte konsumkritische Artikel gestoßen, deren grundsätzlichen Aussagen der Bundesregierung und ihren Kaufappellen sicher nicht gefallen dürften, die jedoch, jeder auf seine Art, die (oft negativen) Facetten unserer Konsumgesellschaft beleuchten. Sicherlich ist es kein Zufall, dass gerade vor Weihnachten der eine oder andere mal innehält und sich so seine Gedanken über das Treiben, das sich in den Innenstädten und Shoppingcentern der Welt macht, denn zu keiner anderen Jahreszeit steht der Konsum so dermaßen offen im Mittelpunkt des allgemeinen Treibens. Aus einem spontanen, freudigen Schenkakt ist über die Jahre ein echter Krampf geworden – als ich selbst noch an diesem Ritual teilnahm (seit Jahren verschenke ich nichts mehr zu Weihnachten) waren die Tage vor dem Fest von echtem Stress begleitet, da ich ja noch auf Teufel komm raus irgendetwas für den einen oder anderen finden musste. Und so wurde viel Unnützes ausgetauscht und womöglich direkt nach den Feiertagen nie wieder benutzt. (Wobei schenken und beschenkt werden durchaus auch Spaß machen kann, das ist klar.)
In den letzten Tagen bin ich beim Herumstöbern im Netz auf drei sehr lesenswerte konsumkritische Artikel gestoßen, deren grundsätzlichen Aussagen der Bundesregierung und ihren Kaufappellen sicher nicht gefallen dürften, die jedoch, jeder auf seine Art, die (oft negativen) Facetten unserer Konsumgesellschaft beleuchten. Sicherlich ist es kein Zufall, dass gerade vor Weihnachten der eine oder andere mal innehält und sich so seine Gedanken über das Treiben, das sich in den Innenstädten und Shoppingcentern der Welt macht, denn zu keiner anderen Jahreszeit steht der Konsum so dermaßen offen im Mittelpunkt des allgemeinen Treibens. Aus einem spontanen, freudigen Schenkakt ist über die Jahre ein echter Krampf geworden – als ich selbst noch an diesem Ritual teilnahm (seit Jahren verschenke ich nichts mehr zu Weihnachten) waren die Tage vor dem Fest von echtem Stress begleitet, da ich ja noch auf Teufel komm raus irgendetwas für den einen oder anderen finden musste. Und so wurde viel Unnützes ausgetauscht und womöglich direkt nach den Feiertagen nie wieder benutzt. (Wobei schenken und beschenkt werden durchaus auch Spaß machen kann, das ist klar.)