 Das kanadische Adbusters-Magazin – das wohl bekannteste Organ der Culture Jammer – wählt jedes Jahr die „Person des Jahres“. 2008 war dies der Wirtschaftswissenschaftler Herman Daly, der für seine unorthodoxen Ansichten bekannt ist. Ich präsentiere Euch heute, mit freundlicher Genehmigung, meine Übersetzung der Adbusters-Laudatio sowie Dalys anregenden Artikel „A Steady-State Economy“ aus Adbusters 01/2009. [Da der Artikel auch manches an Fachvokabular enthält, das zu übersetzen mir nicht so ohne weiteres gegeben ist, habe ich bei einigen Begriffen Links zu erklärenden Seiten eingefügt; sollte ich Übersetzungsfehler gemacht haben, bitte ich um entsprechenden Hinweis. Teils holprige Sätze bitte ich mir dementsprechend auch nachzusehen.]
Das kanadische Adbusters-Magazin – das wohl bekannteste Organ der Culture Jammer – wählt jedes Jahr die „Person des Jahres“. 2008 war dies der Wirtschaftswissenschaftler Herman Daly, der für seine unorthodoxen Ansichten bekannt ist. Ich präsentiere Euch heute, mit freundlicher Genehmigung, meine Übersetzung der Adbusters-Laudatio sowie Dalys anregenden Artikel „A Steady-State Economy“ aus Adbusters 01/2009. [Da der Artikel auch manches an Fachvokabular enthält, das zu übersetzen mir nicht so ohne weiteres gegeben ist, habe ich bei einigen Begriffen Links zu erklärenden Seiten eingefügt; sollte ich Übersetzungsfehler gemacht haben, bitte ich um entsprechenden Hinweis. Teils holprige Sätze bitte ich mir dementsprechend auch nachzusehen.]
——————————————————————————-
Das TIME magazine hat gerade seine „Person des Jahres“ bekannt gegeben, und ja, Sie haben’s erraten, sie entschieden sich für Obama. Diese Wahl ist zweifellos eine gute, aber es ist eine gefahrlose Wahl, innerhalb der Grenzen des „business as ususal“. Adbusters „Person des Jahres“ ist Herman Daly, ein subversiver Denker, dessen Ideen in Richtung eines verlockenden Auswegs aus der globalen Erderwärmung und ökonomischer Zusammenbruchsszenarien weisen, in denen wir derzeit gefangen sind. Herman Daly ist „die wahre Sache“: der „memester des Jahres“ (Anm. PM: „memester“ ist jemand, der dafür sorgt, Meme (Gedanken-Gene) in Umlauf zu bringen und damit den Meinungsmainstream zu durchbrechen). Finden Sie heraus, wieso wir bei adbusters.org ausgerechnet ihn gewählt haben.
Herman Daly ist nicht der normale neoklassische Ökonom, obwohl er es hätte sein können, wenn es nicht einige Schlüsselerlebnisse in seinem Leben gegeben hätte. Wie die meisten Studenten der Wirtschaftswissenschaften glaubte auch Daly einst, dass Wachstum der Schlüssel zur Lösung der Menschheitsprobleme ist. Aber während er seinen Doktortitel unter der Leitung von einem der renommiertesten Ökonomen der damaligen Zeit – Nicholas Georgescu-Roegen – machte, wurde Dalys Vertrauen in das Wachstum erschüttert.
Obwohl er einige beachtliche Beiträge zum Gebiet der neoklassischen Ökonomie geleistet hatte, begann Georgescu-Roegen zu der Zeit, als er Dalys Doktorvater wurde, kritische Schwächen der neoklassischen Theorie zu entdecken: sie versäumte, zu berücksichtigen, wie wirtschaftliche Prozesse Ressourcen verschlingen und Müll produzieren. Weiteres Wachstum bedeutete eine schnellere Rate der Ressourcenauslöschung und noch mehr Müll. Diese Saat des Zweifels, die Georgescu-Roegen in Dalys jungen Geist einpflanzen konnte, begann zu wachsen, als Daly „Silent Spring“ las, ein bahnbrechendes Buch, das vor den Gefahren von Industriechemikalien in der Nahrungskette warnte. Nachdem er einen Lehrauftrag in Brasilien im Jahre 1968 angenommen hatte, beobachtete Daly aus erster Hand, wie Bevölkerungswachstum die Umwelt vor Ort negativ beeinflusste. Sein Glaube an das Wachstum war zerronnen. Seinen Platz nahm eine schwerwiegende Sorge ein über die offensichtliche Gleichgültigkeit, die seine Kollegen in den Wirtschaftswissenschaften gegenüber der Beziehung zwischen Wirtschaft und Umwelt an den Tag legten.
Vier Jahrzehnte lang arbeitete Daly unermüdlich daran, das Wachstumsdogma, das die moderne Gesellschaft so enthusiastisch verinnerlicht hat, herauszufordern. Er veröffentlichte mehrere Bücher und mehr als 100 Artikel, und Daly versuchte sogar, Veränderung von innen heraus zu bewirken, als er sechs frustrierende Jahre bei der Weltbank verbrachte, wo er beobachten musste, welch fehlgeleitete Politik aus einer „unrealistischen Vorstellung von Entwicklung als Verallgemeinerung des nördlichen Konsumüberflusses“ entsprang.
Dadurch, dass viele Naturwissenschaftler gezeigt haben, dass wir, wenn wir einen katastrophalen Klimawandel verhindern wollen, aufhören müssen, CO2 in die Atmosphäre zu pumpen, beginnen Mainstream-Ökonomen grummelnd, die Tatsache zu akzeptieren, dass es ökologische Grenzen für unser Wachstum gibt. Während die Mehrheit sich immer noch nicht eingestanden hat, dass Wachstum ein falsches Idol ist, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass, sobald eine Grenze erst einmal akzeptiert wurde, andere folgen werden. Sobald diese Grenzen akzeptiert sind, beginnt die gesamte Logik des permanenten Wachstums in sich zusammen zu brechen.
———————
Herman Daly:
Ein Wirtschaftssystem des langfristigen Gleichgewichts (Steady-State-Ökonomie)
Die Wachstumsökonomie geht in die Knie und wir müssen eine Ökonomie des stabilen Zustands (des langfristigen Gleichgewichts/Steady-State) anstreben. Die Antwort des Steady-State ist, dass die Reichen ihr Wachstum an (Ressourcen-)Durchsatz reduzieren, um Ressourcen und ökologischen Raum für die Armen freizusetzen, während sie ihre lokalen Bemühungen auf Entwicklung, technische und soziale Verbesserungen konzentrieren, die frei mit den armen Ländern geteilt werden können.
 Die Erde als Ganzes befindet sich näherungsweise in einem langfristigen Gleichgewicht. Weder die Oberfläche noch die Masse der Erde wächst oder schrumpft; der Zufluss an Strahlenenergie entspricht dem Abfluss (der Treibhauseffekt hat die Abstrahlung verlangsamt, aber der daraus resultierende Temperaturanstieg wird sie wieder vergrößern); und Materialimporte aus dem Weltraum sind ca. so groß wie die Exporte (beides vernachlässigbare Größen).
Die Erde als Ganzes befindet sich näherungsweise in einem langfristigen Gleichgewicht. Weder die Oberfläche noch die Masse der Erde wächst oder schrumpft; der Zufluss an Strahlenenergie entspricht dem Abfluss (der Treibhauseffekt hat die Abstrahlung verlangsamt, aber der daraus resultierende Temperaturanstieg wird sie wieder vergrößern); und Materialimporte aus dem Weltraum sind ca. so groß wie die Exporte (beides vernachlässigbare Größen).
Dies bedeutet jedoch nicht, dass die Erde statisch wäre – eine Vielzahl an qualitativen Veränderungen kann in einem stabilen Zustand vor sich gehen, und hat definitiv auch auf der Erde stattgefunden. Die wichtigste Änderung in der jüngeren Zeit war das enorme Wachsen eines Untersystems der Erde, der Wirtschaft, in Relation zum Gesamtsystem, der Ökosphäre. Dieser gewaltige Schritt von einer „leeren“ zu einer „vollen“ Erde ist wirklich „Etwas Neues unter der Sonne“, wie der Historiker J.R. McNeil in seinem Buch mit dem selben Titel schreibt. Je mehr sich die Wirtschaft der Größe der gesamten Erde annähert, desto stärker muss sie sich der physikalischen Verhaltensweise der Erde fügen. Und diese Verhaltensweise ist ein stabiler Zustand – ein System, das qualitative Entwicklung erlaubt, aber kein endloses aggregiertes quantitatives Wachstum vorsieht. Wachstum ist mehr von der gleichen Sache; Entwicklung ist die gleiche Menge von besseren (oder zumindest anderen) Sachen. Die verbleibende natürliche Welt ist nicht mehr länger in der Lage, die Quellen und Abflüsse für den Stoffwechseldurchsatz zur Verfügung zu stellen, der nötig ist, um die derzeitige überdimensionierte Wirtschaft am Laufen zu halten – und erst recht keine weiter wachsende Wirtschaft. Ökonomen haben sich zu sehr auf den Wirtschaftskreislauf konzentriert und dabei vergessen, den Verdauungstrakt zu studieren. Wachsender Durchsatz bedeutet mehr von der gleichen Nahrung durch einen noch größeren Verdauungstrakt zu pressen; Entwicklung bedeutet, bessere Nahrung zu essen und diese gründlicher zu verdauen. Es ist eindeutig, dass die Wirtschaft sich an die Regeln eines stabilen Zustands anpassen muss – qualitative Entwicklung anstreben, aber anhäufendes quantitatives Wachstum stoppen. Der Anstieg des Bruttoszialprodukts (BSP) verschmelzt diese beiden sehr unterschiedlichen Dinge.
200 Jahre lang haben wir in einer Wachstumswirtschaft gelebt. Das macht es schwierig, sich vorzustellen, wie eine Steady-State-Ökonomie (SSÖ) aussehen würde, obwohl die Menschheit die meiste Zeit ihrer Geschichte in einem Wirtschaftssystem gelebt hat, in dem jährliches Wachstum vernachlässigbar war. Einige denken, eine SSÖ würde bedeuten, unter einer kommunistischen Diktatur festzufrieren. Einige sagen, dass großer technischer Fortschritt (Energieeffizienz, Recycling) so einfach ist, dass die Anpassungen dadurch sowohl profitabel werden wie auch Spaß machen würden.
Unabhängig davon, ob es hart oder einfach wird, müssen wir eine SSÖ zu erreichen versuchen, weil wir nicht weiter wachsen können, und tatsächlich ist das sogenannte „wirtschaftliche“ Wachstum bereits unwirtschaftlich geworden. Die Wachstumswirtschaft versagt. Mit anderen Worten, die quantitative Ausbreitung des wirtschaftlichen Subystems erhöht Umwelt- und soziale Kosten stärker als die Produktion profitiert, was uns ärmer und nicht reicher macht, zumindest in den Hochkonsum-Ländern. Wenn man die Gesetze des sinkenden Grenznutzens und steigender Grenzkosten bedenkt, kann dies nicht überraschen. Und manchmal macht neue Technologie es sogar noch schlimmer. Zum Beispiel brachte Bleifluid den Vorteil, Maschinenklopfen zu verringern, dafür wird ein giftiges Schwermetall in die Biosphäre gepustet; Fluorkohlewasserstoffe brachten uns nichtgiftige Treibgase und Kühlmittel, aber zum Preis eines Lochs in der Ozonschicht und einer daraus resultierenden verstärkten ultravioletten Strahlung. Es ist schwer definitiv festzustellen, dass das Wachstum inzwischen die Kosten stärker steigen lässt als den Nutzen, weil wir uns nicht darum kümmern, die Kosten vom Nutzen in unseren volkswirtschaftlichen Rechnungen zu trennen. Statt dessen fassen wir bei der Berechnung des Bruttosozialprodukts (BSP) beides zusammen als „Aktivität“.
Ökologisch orientierte Ökonomen haben die empirischen Belege geführt, dass Wachstum in den Hochkonsum-Ländern bereits unwirtschaftlich ist. Da neoklassische Ökonomen nicht in der Lage sind, zu beweisen, dass Wachstum, ob nun als Verarbeitungsmenge oder als BSP, uns besser da stehen lässt und nicht schlechter, stellt dies eine blinde Ignoranz von ihrer Seite dar, wenn sie weiterhin anhäufendes Wachstum als die Lösung unserer Probleme predigen. Ja, die meisten unserer Probleme (Armut, Arbeitslosigkeit, Umweltschäden) wären leichter zu lösen, wenn wir reicher wären – das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist: Macht uns ein Wachstum des Bruttosozialprodukts nach wie vor wirklich reicher? Oder macht es uns inzwischen eher ärmer?
Für arme Länder bedeutet ein Anstieg des BSP nach wie vor eine Erhöhung des Gemeinwohls, zumindest, wenn es vernünftig verteilt wird. Die Frage ist, was die beste Möglichkeit für die reichen Länder ist, um den ärmeren zu helfen? Die Antwort der Weltbank besteht darin, dass die Reichen weiterhin so schnell wie nur irgend möglich wachsen sollen, um Märkte für die Armen bereitzustellen und Kapital anzusammeln, um in ärmeren Ländern zu investieren. Die Antwort des Steady-State ist, dass die Reichen ihr Durchsatzwachstum verringern, um Ressourcen und ökologischen Raum freizugeben, den die Armen nutzen können, während sie ihre lokalen Bemühungen auf Entwicklung, technische und soziale Verbesserungen konzentrieren, die frei mit den armen Ländern geteilt werden können.
Die Mobilität des internationalen Kapitals, kombiniert mit freiem Handel, erlaubt es den Konzernen, den in öffentlichem Interesse betriebenen nationalen Regulierungen zu entfliehen, und ein Land gegen das andere auszuspielen. Da es keine weltweite Regierung gibt, sind sie in der Tat unkontrolliert. Die Institutionen, die noch am ehesten einer globalen Regierung entsprechen (Weltbank, Internationaler Währungsfond, Welthandelsorganisation), haben keinerlei Interesse daran gezeigt, transnationales Kapital zugunsten des Allgemeinwohls zu regulieren. Ihr Ziel ist es, diesen Konzernen zu helfen, zu wachsen, da unterstellt wird, dass Wachstum gut für alle ist – Ende der Diskussion. Wenn der Internationale Währungsfond den Wunsch hätte, die Mobilität des internationalen Kapitals zu begrenzen, um in der Welt komparative Vorteile zu sichern, gäbe es einige Dinge, die er tun könnte. Er könnte Mindesthaltedauern von ausländischem Kapital einführen, um Kapitalflucht und Spekulation einzudämmen und er könnte eine kleine Steuer auf alle Währungstransaktionen (Tobin-Steuer) fordern. Vor allem könnten sie Keynes Vorschlag einer multilateralen International Clearing Union wiederbeleben, das andauernde Ungleichgewichte der Handelsbilanzen (sowohl Defizite wie auch Überschüsse) direkt bestrafen und damit indirekt ein Gleichgewicht in den dem Handel zugrunde liegenden Kapitalbilanzen fördern würde, was zu einer Reduzierung der internationalen Kapitalströme führt.
Besteuerung der Sachen, von denen wir weniger wollen (Zerstörung und Verschmutzung) und Zurücknahme von Steuern bei Dingen, von denen wir mehr möchten (Einkommen, Wertzuwachs) – wie es auf Autoaufklebern steht: „Besteuere Schlechtes, nicht Gutes (Güter)“. Beginnen wir zum Beispiel, indem wir auf x $ Gewinn von der schlimmsten Wertzuwachssteuer, die wir haben, verzichten. Gleichzeitig sammeln wir x $ von der besten Ressourcenverbrauchssteuer, die wir ersinnen können. In der nächsten Legislaturperiode schaffen wir die zweitschlimmste Steuer auf Wertzuwachs ab und ersetzen sie durch die zweibeste Ressourcen-Steuer etc. Solch eine Politik würde die Ressourcenpreise erhöhen und stärkere Effizienz in der Ressourcenverwendung bewirken.
Wissen wird, anders als Warendurchsatz, nicht verringert, wenn man es teilt, sondern vervielfältigt. Sobald Wissen existiert, betragen die Opportunitätskosten des Teilens Null und somit sollte auch der Preis, es zu verteilen, Null sein. Internationale Entwicklungshilfe sollte mehr und mehr die Form von frei und aktiv geteiltem Wissen annehmen, begleitet von kleinen Kapitalhilfen, und weniger die Form gewaltiger zinsbelasteter Kredite. Wissen zu teilen kostet wenig, erzeugt keine Schulden, die eh niemals zurück bezahlt werden können, und es erhöht die Produktivität der wirklich konkurrierenden und knappen Produktionsfaktoren. Existierendes Wissen ist der wichtigste Input für die Produktion neuen Wissens, und dieses künstlich knapp und teuer zu halten, ist pervers. Patentmonopole (wie „Rechte an geistigem Eigentum“) sollten eine kürzere Laufzeit haben und nicht für so viele „Erfindungen“ erteilt werden wie derzeit.
Könnte ein Wirtschaftssystem des Steady-State die aktuelle gewaltige Finanzstruktur stützen, die auf den Erwartungen zukünftigen Wachstums aufbaut? Wahrscheinlich nicht, weil Zinssätze und Wachstumsraten niedrig wären. Investitionen bestünden primär in Ersatzinvestitionen und qualitativen Verbesserungen. Es gäbe vermutlich ein gesundes Schrumpfen der gigantischen Schuldpyramide, die bedrohlich über der Realwirtschaft schwebt und einzustürzen droht. Außerdem würde eine SSÖ von der Abkehr von unserem derzeitigen Mindestreserve-Bankwesen hin zu einem System des 100%igen Rückstellungsbedarfs (100%ige Eigenkapitalquote?) profitieren.
Dies würde unsere Geldversorgung zurück in die Hände der Regierungen legen statt sie in den Händen des privaten Bankensektors zu belassen. Geld wäre ein wirkliches politisches Instrument anstatt nur das Nebenprodukt von kommerziellem Leihen und Verleihen mit dem Ziel der Wachstumssteigerung. In dem Mindestreserven-System wird die Geldversorgung während eines Booms ausgeweitet und während eines Abschwungs verringert und verstärkt somit die zyklischen Tendenzen der Wirtschaft. Der Profit (Geldschöpfung) des Erschaffens (zu vernachlässigbaren Kosten) und der erste zu sein, neues Geld ausgeben zu können – und dessen vollen Tauschwert zu erhalten – würde der Allgemeinheit zugute kommen statt dem privatwirtschaftlichen Sektor. Die Rückstellungsanforderungen – etwas, das die Zentralbank sowieso manipuliert/beeinflusst – könnten von ihrem momentan sehr niedrigen Niveau schrittweise auf 100 Prozent angehoben werden. Kommerzielle Banken würden ihr Geld mit finanziellen Vermittlungen verdienen (indem sie das Geld von Kreditgebern an Kreditnehmer vermitteln) sowie durch Servicegebühren für Kontobewegungen, anstatt Geld, das sie aus dem Nichts schöpfen, zu Zinssätzen zu verleihen. Geld zu verleihen, das tatsächlich von jemandem gespart wurde, stellt das klassische Gleichgewicht zwischen Zurückhaltung und Investition wieder her. Diese zusätzliche Disziplinierung beim Leihen und Verleihen würde solche Debakel wie bei der aktuellen „Subprime-Krise“ verhindern. Hundertprozentige Rückstellungsverpflichtungen würden sowohl die Wirtschaft stabilisieren als auch das Schneeballsystem der Kredithebelungen bremsen.
Diese Übergangsmaßnahmen mögen vielen Menschen radikal erscheinen, wir sollten aber im Hinterkopf behalten, dass sie nicht nur eine nach und nach angewendet werden können, sondern auch auf den konservativen Pfeilern von Privateigentum und dezentraler Marktverteilung basieren. Sie erkennen ganz einfach an, dass Privateigentum seine Legitimation verliert, wenn es zu ungleich verteilt ist und dass der Markt seine Legitimation verliert, wenn die Preise nicht die volle Wahrheit über die Kosten widerspiegeln. Außerdem wird Makroökonomie absurd, wenn ihre Größenordnung von der Grundstruktur her erfordert, über die biophysikalischen Grenzen der Erde hinaus zu wachsen. Und lange vor dieser radikalen phsyikalischen Grenze stoßen wir auf die konservative ökonomische Grenze, dass die Zusatzkosten für weiteres Wachstum größer werden als der daraus resultierende zusätzliche Nutzen.
Abstand nehmen vom Umkipppunkt
Zehn grundlegend entscheidende Schritte, um eine ökologisch lebensfähige ökonomische Zukunft zu erlangen
1. „Cap auction trade systems“ für grundlegende Ressourcen (kann ich schwer übersetzen; wohl vergleichbar mit der von Versteigerung von Verschmutzungsrechten o.ä.; Anm. PM) – Eine Begrenzung nach oben für biophysikalische Größen, in Bezug auf die Knappheit der Quelle (Ressourcen) oder des Abflusses (Müll), je nach dem, was knapper ist. Die Versteigerung erfasst die Knappheitsrenten (den Preis für knappe Güter) für eine gleichberechtigte Weiterverteilung. Handel erlaubt eine effiziente Allokation auf die besten Verwendungsmöglichkeiten.
2. Ökologische Steuerreform – Der Fokus der Steuern wandert von der Besteuerung von Wertzuwachs (Arbeit und Kapital) hin zu dem, „wozu der Wert hinzugefügt wird“, insbesondere der entropischen Verarbeitungsmenge von Ressourcen, die der Natur von der Wirtschaft entzogen wird (Abbau), und anschließend wieder zurück in die Natur gelangt (Verschmutzung). Dies internalisiert externe Kosten und erhöht Umsätze auf gerechtere Weise. Somit preist dies den knappen, aber bisher nicht eingepreisten Beitrag der Natur in die Produktionskosten ein.
3. Begrenzung des Ausmaßes an Ungleichgewicht in der Einkommensverteilung – Ein Minimal- und ein Maximaleinkommen. Ohne aggregiertes Wachstum setzt Armutsreduktion Umverteilung voraus. Vollständige Gleichheit ist unfair; unbegrenzte Ungleichheit ist unfair. Strebt faire Grenzen der Ungleichheit an.
4. Verkürzung der Länge eines Arbeitstages, einer Arbeitswoche, eines Arbeitsjahres – Dies erlaubt größere Freiheiten für Freizeit oder persönliche Arbeit. Vollbeschäftigung für alle ist ohne Wachstum kaum zu erreichen.
5. Regulierung des internationalen Handels – Eine Abkehr vom freien Handel, freier Kapitalmobilität und Globalisierung; kompensatorische Tarife/Zölle/Gebühren werden eingeführt, um eine effiziente nationale Politik der Kosteninternalisierung vor der Standard-senkenden Konkurrenz durch andere Länder zu schützen.
6. IWF, Weltbank und WTO werden zurückgestuft auf ein Niveau, das Keynes Plan für eine multilaterale, internationale Clearing Union entspricht, die Strafgebühren auf Bilanzüberschüsse oder -defizite der Länder erhebt; dies ermöglicht ein Gleichgewicht der Währungskonten, verhindert riesige Kapitaltransfers und Schulden im Ausland.
7. Übergang zu einer 100%igen Eigenkapitalquote statt des Mindestreserven-Banksystems. Die Kontrolle über die Geldversorgung und -schöpfung wird in die Hände der Regierung anstatt privater Banken gelegt.
8. Die verbleibenden Allgemeingüter von konkurrierendem natürlichen Kapitel (? „rival natural capital“) werden in öffentliche Treuhandgesellschaften überführt und mit Preisen versehen, wodurch sie von privater Beschränkung befreit sind und die nicht-konkurrierenden Allgemeingüter Wissen und Information einen Preis erhalten. Damit wird ein Schlussstrich unter das bisherige Verhalten gezogen, das Knappe so zu behandeln, als wäre es nicht knapp, und das Nicht-Knappe als knapp.
9. Stabilisierung der Bevölkerung – Hinarbeiten auf ein Gleichgewicht, in dem Geburten plus Einwanderer der Summe von Sterbefällen und Auswanderern entsprechen.
10. Reform der volkswirtschaftlichen Konten – Aufteilung des Bruttosozialprodukts in ein Kosten- und ein Ertragskonto. Vergleicht sie anhand der Marge (? „marge“ / Grenznutzen?) und stoppt das Wachstum, sobald die Grenzkosten den Grenzerlösen entsprechen. Auf keinen Fall werden diese beiden Konten zusammengezählt.

Verwandte Beiträge:
 Vor einer Weile stieß ich im Finanzcrash-Forum auf einen interessanten Beitrag eines Users namens Otto Lidenbrock – er beschreibt sehr gut die Problematik, der man sich als jemand, der seine Stimme gegen den Mainstream und gegen Missstände erhebt, quasi dauernd im täglichen Miteinander ausgesetzt sieht. Dass man nämlich bei so manchem Zeitgenossen auf frustrierende Abwehrmechanismen stößt, auch auf eine gewisse Art von Ignoranz, die sicher auch in einer Angst vor jeglicher Veränderung begründet ist – am besten alles so lassen, egal wie bedrückend die aktuelle Situation auch sein mag. Ich finde das Motto „Ich weiß nicht, ob es besser wird, wenn es anders wird, aber es muss anders werden, um besser zu werden“ eigentlich hilfreicher. ;-) Hier also der komplette Beitrag:
Vor einer Weile stieß ich im Finanzcrash-Forum auf einen interessanten Beitrag eines Users namens Otto Lidenbrock – er beschreibt sehr gut die Problematik, der man sich als jemand, der seine Stimme gegen den Mainstream und gegen Missstände erhebt, quasi dauernd im täglichen Miteinander ausgesetzt sieht. Dass man nämlich bei so manchem Zeitgenossen auf frustrierende Abwehrmechanismen stößt, auch auf eine gewisse Art von Ignoranz, die sicher auch in einer Angst vor jeglicher Veränderung begründet ist – am besten alles so lassen, egal wie bedrückend die aktuelle Situation auch sein mag. Ich finde das Motto „Ich weiß nicht, ob es besser wird, wenn es anders wird, aber es muss anders werden, um besser zu werden“ eigentlich hilfreicher. ;-) Hier also der komplette Beitrag: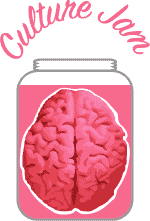 Manche dieser Beobachtungen finde ich wirklich gut getroffen und ich kann sie nur bestätigen, allerdings sähe mein Fazit nicht so negativ-resigniert aus, da es mir in der Vergangenheit durchaus des öfteren gelungen ist, Menschen in meinem Umfeld auf Missstände aufmerksam zu machen und auch zu Änderungen anzustiften. Wie ich schon einmal z.B. bezüglich de „Spiels“ society conspiracy erwähnte, kommt es darauf an, sich zu wehren und immer wieder unverzagt andere, neue, „subversive“ Gedanken in seine Umgebung einfließen zu lassen. Natürlich schwenkt nicht sofort jeder ein und wacht auf, aber oft ist es ja schon ein Erfolg, wenn es einem gelingt, erste Zweifel an einem eigentlich für unveränderlich geltenden Zustand oder einem Image (z.B. einer Firma) zu wecken und bei dem einen oder anderen einen allmählichen Nachdenkprozess anzuregen. Manchmal sind es schon die kleinen Erfolge, die einen dann motivieren – wenn man es schafft, dass jemand ein paar Mal weniger zu McDoof oder Aldi geht, weil man sein schlechtes Gewissen geweckt hat. Wenn jemand nicht mehr einfach blind alles glaubt, was im Fernsehen oder der Zeitung steht. Wenn jemand unbequeme Fragen zu stellen beginnt. Usw. usf. Deshalb darf man sich auf keinen Fall entmutigen lassen, auch nicht von denjenige, die meinen, alles besser zu wissen und die uns IHRE destruktiven Meme („Widerstand ist zwecklos“, „Bringt ja doch alles nichts“, „Was kann ich schon ausrichten?“, „Es gibt keine Alternativen“ usw.) einflüstern wollen. Nö!
Manche dieser Beobachtungen finde ich wirklich gut getroffen und ich kann sie nur bestätigen, allerdings sähe mein Fazit nicht so negativ-resigniert aus, da es mir in der Vergangenheit durchaus des öfteren gelungen ist, Menschen in meinem Umfeld auf Missstände aufmerksam zu machen und auch zu Änderungen anzustiften. Wie ich schon einmal z.B. bezüglich de „Spiels“ society conspiracy erwähnte, kommt es darauf an, sich zu wehren und immer wieder unverzagt andere, neue, „subversive“ Gedanken in seine Umgebung einfließen zu lassen. Natürlich schwenkt nicht sofort jeder ein und wacht auf, aber oft ist es ja schon ein Erfolg, wenn es einem gelingt, erste Zweifel an einem eigentlich für unveränderlich geltenden Zustand oder einem Image (z.B. einer Firma) zu wecken und bei dem einen oder anderen einen allmählichen Nachdenkprozess anzuregen. Manchmal sind es schon die kleinen Erfolge, die einen dann motivieren – wenn man es schafft, dass jemand ein paar Mal weniger zu McDoof oder Aldi geht, weil man sein schlechtes Gewissen geweckt hat. Wenn jemand nicht mehr einfach blind alles glaubt, was im Fernsehen oder der Zeitung steht. Wenn jemand unbequeme Fragen zu stellen beginnt. Usw. usf. Deshalb darf man sich auf keinen Fall entmutigen lassen, auch nicht von denjenige, die meinen, alles besser zu wissen und die uns IHRE destruktiven Meme („Widerstand ist zwecklos“, „Bringt ja doch alles nichts“, „Was kann ich schon ausrichten?“, „Es gibt keine Alternativen“ usw.) einflüstern wollen. Nö!


 Das kanadische Adbusters-Magazin – das wohl bekannteste Organ der Culture Jammer – wählt jedes Jahr die „
Das kanadische Adbusters-Magazin – das wohl bekannteste Organ der Culture Jammer – wählt jedes Jahr die „

