Interessanter und auf gewisse Weise auch etwas erschreckender Kurzfilm „Did you know?” von Karl Fisch zum exponentiellen Wachstum vieler Entwicklungen und Dinge in unserem modernen Leben. Jeder kann sich selbst ausmalen, wie und ob das wohl ewig so weitergehen kann… (siehe auch den New Scientist-Artikel hier) Das Team um Karl Fisch sieht, wie ich mal gelesen habe, dieses exponentielle Wachstum auf technischem Gebiet wohl durchaus positiv und mit einem gewissen Stolz, nur stellt sich schon die Frage, ob das persönliche Wachstum und das der Gesellschaft als Ganzes dieses (sich immer weiter steigernde) Tempo ohne größere Verwerfungen wird mitmachen können. Exponentielle Steigerungen sind, außer bei Krebs o.ä., nun mal nicht natürlich und vor allem nicht nachhaltig.
Wenn es darum geht, die Sprache zu vergewaltigen, sind Werbetreibende ja seit jeher ganz vorn mit dabei. Das hier habe ich gerade auf einer Website gesehen:

Eine sehr kreative Trennweise. Und auch zum Nachdenken anregend – geht es vielleicht wirklich um SMS-Verse? Aber ist es so gut, wenn man frisch geschmiedete Verse „ndet”?
Verwandte Beiträge:
Na herzlichen Dank an die Lobby der großen Verlage, kann man da nur sagen, wenn man den neuen, gestern von den Ministerpräsidenten beschlossene Rundfunk-Staatsvertrag betrachtet, der noch ratifiziert werden muss. Demnach soll den öffentlich-rechtlichen Sendern ab Mai 2009 verboten werden, in ihren Mediatheken, in denen man bisher viel interessantes Archivmaterial kostenlos (okay, wir haben’s ja auch schon via GEZ bezahlt) finden konnte, Sendungen länger als 6 Tage zur Verfügung zu stellen. Eigentlich ein unglaublicher Eingriff in die Medienfreiheit, und das alles unter dem Protektorat des Verbandes Deutscher Zeitschriftenverleger, die nun also unter dem Schlachtruf „Wettbewerbsverzerrung!” zu verhindern suchen, dass Material, das für den einen oder anderen Bürger vielleicht auch noch nach einigen Wochen oder Monaten relevant sein könnte, abrufbar ist. Wie gesagt, vielen Dank. Eigentlich ist das ein ungeheuerlicher Vorgang, der jedoch bislang kaum im großen Maße für Wirbel gesorgt hat – einige Blogs haben dieses Thema jedoch schon aufgegriffen: Megahoschi, Duckhome und Fefe z.B.
Nun gibt es auch im öff.-rechtlichen Fernsehen natürlich jede Menge Mist, der es wohl Wert ist, schnell in Vergessenheit zu geraten, aber dennoch finden sich immer wieder Perlen (wie bei Frontal 21), die möglichst lange online erreichbar sein sollten.
Verwandte Beiträge:
„Ich glaube, dass wir in unserem Geldsystem eine Art karzinombildendes Element haben, was unsere Wirtschaft fortwährend krank macht… Meiner Meinung nach kann dieses Geldsystem nur dadurch funktionieren, dass es immer wieder zusammenbricht und dann wieder von vorn begonnen wird. Diese Zusammenbrüche nennt man dann Kriege, Wirtschaftskrisen oder Inflationen, je nachdem, aber das bedeutet nur, dass dieses System in sich selbst kein Regulativ hat, was zu einer vernünftigen Eindämmung führen würde.“ Michael Ende, dt. Autor 1992
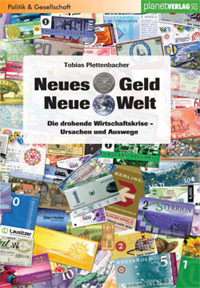
Dass Geld und der Geldkreislauf in der Form, wie wir sie derzeit kennen und nutzen, viele Probleme mit sich bringt (insbesondere die Zinseszinsproblematik), hatte ich ja schon an einigen Stellen erörtert (hier oder hier). Dennoch ist dies für die meisten Menschen ein Thema, über das sie eigentlich nie wirklich nachdenken – Geld scheint einfach da zu sein, man geht zur Bank, um sich neues Geld zu holen und kauft anschließend damit ein. Darüber, dass unser jetziges System keineswegs ein naturgegebener, unveränderlicher Zustand ist, haben sich jedoch in den letzten Jahrzehnten und Jahrhunderten bereits so manche Experten Gedanken gemacht. Gerade in der heutigen Zeit, in der die „Finanzkrise” die systemimmanenten Fehler eigentlich für jedermann offenbart, sind neue Ideen, wie man Währungen anders organisieren kann, vonnöten.
Tobias Plettenbacher, Mitglied von Attac in Österreich und Mitinitiator von timeSOZIAL, hat sich solche Gedanken gemacht. In seinem Buch „Neues Geld, neue Welt. Die drohende Wirtschaftskrise – Ursachen und Auswege”, das im planet Verlag erschienen ist, das er jedoch auch als kostenlosen pdf-Download (in CC-Lizenz) anbietet, bietet er auf gut 150 Seiten eine leicht verständliche Einführung ins Thema Geld und alternative Währungssysteme.
Insgesamt 5 Teile umfasst sein Werk – im ersten Teil geht der Autor auf das „normale” Geld ein und arbeitet die einzelnen Probleme heraus, die dieses für die Gesellschaft, die Umwelt und auch die Wirtschaft (vor allem die kleinen und mittelständischen Betriebe) mit sich bringt. Denn wer jetzt auf „gierige Banker” etc. schimpft, macht es sich zu leicht. Teil zwei schildert theoretische Lösungsansätze, um aus dem Zinsdilemma und dem zerstörerischen Finanzsystem heraus zu kommen. Hier wird u.a. die Tobin-Steuer, aber auch Vollgeld und Geldökologie angesprochen. Im dritten Teil beleuchtet Plettenbacher dann die Geschichte von alternativen Währungssystemen, die von den Herrschenden auch früher nicht gerne gesehen und oftmals, wenn diese neuen Währungen zu erfolgreich zu werden drohten, abgewürgt und verboten wurden. Das bekannteste Beispiel war das „Wörgl-Experiment” in Österreich Anfang der 30er Jahre des letzten Jahrhunderts. Teil Nummer 4 wendet sich anschließend der Gegenwart zu und beschreibt die Vielzahl von Initiativen, die es weltweit im Bereich komplementärer und alternativer Währungen gibt – vom Chiemgauer regional über den VOLMEtaler (Hagen), das LETS-System in den USA und schließlich dem größten und erfolgreichsten Projekt in diesem Bereich, dem Pflegemodell Fureai Kippu in Japan mit mehreren Millionen Mitgliedern. Es ist wirklich erstaunlich, wie viel hier schon getan wird, ohne dass die Mainstreammedien darüber nennenswert berichten würden. Im abschließenden Teil des Buches versucht sich Tobias Plettenbacher an einem Komplementären Gesamtmodell, das als Anregung und Grundlage für weitere Überlegungen dienen soll.
Flankiert von zahlreichen Zitaten aus mehreren Jahrhunderten bietet der Autor somit einen zwar sicherlich etwas vereinfachten, aber dennoch gerade für den Laien gut nachvollziehbaren Einstieg in die doch etwas beschwerlich erscheinende Materie Geld und Währungssysteme. Und bei einem unschlagbaren Preis von 0 € für das pdf gibt es sowieso keinen Grund, nicht zumindest einen Blick hinein zu werfen.
> Download des Buches als pdf-File (2.8 MB) <
„Geld und damit Liquidität bleiben in der Region. Wertschöpfung passiert für und in der Region… Regiogeld unterstützt eine Wirtschaftskultur, die auf Kooperation und nicht auf Konkurrenz aufbaut… Regiogeld löst die Abhängigkeit von globalen Tendenzen auf, stärkt die regionale Ökonomie und Identität.“ Slogans der Anhalt Dessau AG
Verwandte Beiträge:
 Wer auf der Suche nach dreisten und schamlosen Reklamelügen ist, wird beim Klima-Lügendetektor regelmäßig fündig. Vor allem die besonders klimaschädlichen Industrien wie Energieversorger und Autobauer versuchen sich via Werbung nachträglich reinzuwaschen bzw. übles Geschäftsgebaren zu verschleiern.
Wer auf der Suche nach dreisten und schamlosen Reklamelügen ist, wird beim Klima-Lügendetektor regelmäßig fündig. Vor allem die besonders klimaschädlichen Industrien wie Energieversorger und Autobauer versuchen sich via Werbung nachträglich reinzuwaschen bzw. übles Geschäftsgebaren zu verschleiern.
Neuestes Beispiel: RWE. Am Werbeetat wird bei diesem Konzern traditionell nicht gespart, und so machte RWE unlängst mit einer Anzeige im Special der ZEIT zum 90. Geburtstag von Helmut Schmidt von sich reden, in der sie peinlich und platt von „Emissiönchen” schwadronierten – zu dumm, dass der International Herald Tribune just zuvor ein vernichtendes Urteil über den EU-Emissionshandel zog: „Polluter’s Windfall: Carbon into gold”. Ursprünglich sollten Luftverschmutzer wie die RWE Emissionsrechte ersteigern und so dazu angehalten werden, möglichst wenig CO2 auszustoßen. In der Praxis sieht diese hübsche Idee (die in Wirtschaftsbüchern auch als „Internalisierung externer Kosten” bezeichnet wird) leider nicht mehr so positiv aus, denn ein Großteil der Rechte werden den Konzernen geschenkt, wobei diese ihre Strompreise dennoch so berechnen, als müssten sie dafür zahlen. Dies darf man getrost als vom Bürger bezahlte Subvention an die Großindustrie bezeichnen.
Four years later, the carbon trading system has created a multibillion-euro windfall for some of the Continent’s biggest polluters, with little or no noticeable benefit to the environment so far.
After heavy lobbying by giant utilities and smokestack industries, which argued that their competitiveness could be impaired, the EU all but scrapped the idea of selling permits. It gave them out for free, in such quantities that the market came close to collapsing because of a glut.
But in line with the original strategy, utilities in countries from Spain to Britain to Poland still put a “market value” on their books for the permits and added some of that putative cost to the prices they charged industrial customers for electricity. And they did not stop there. In one particularly contentious case, regulators in Germany accused utilities of charging customers for far more permits than they were entitled to.
Nowhere was this behavior more evident than at RWE, a major German power company, which has acknowledged that it is the biggest carbon dioxide emitter in Europe. Bank analysts and environmental advocates estimate RWE had received a windfall of roughly €5 billion, or $6.5 billion at current exchange rates, in the first three years of the system, ending in 2007 – more than any other company in Europe.
Vor diesem Hintergrund sind Anzeigenkampagnen, wie RWE sie regelmäßig schaltet, sicherlich zynisch und erbärmlich zu nennen. Der Klima-Lügendetektor titelt dann auch süffisant „Millionen Tönnchen Emissiönchen”.
Verwandte Beiträge:
„Die Zerstörung unserer Lebensgrundlagen ist aus wirtschaftlichen Gründen unverzichtbar. Ein Überleben können wir uns im Interesse des Wirtschaftswachstums nicht leisten.”
[via „Es geht um was”]
Verwandte Beiträge:
Am Dienstag letzter Woche gab es eine der seltenen Sternstunden des deutschen Fernsehens – das ZDF-Magazin Frontal 21, dessen konzern- und politikkritischen Beiträge auch sonst meist sehr zu empfehlen sind, brachte ein 45-minütiges Special über die unheilige Allianz von Politik und Pharma-Industrie/-Lobby: „Das Pharma-Kartell – Wie Patienten betrogen werden”.
Drastisch und ungeschönt wird uns hier vorgeführt, wie die Pharmariesen wie Lilly vor Korruption nicht zurückschrecken, um ihre Interessen durchzusetzen, und dabei auch leichtfertig die Gesundheit der Menschen aufs Spiel setzen. Ebenfalls Gänsehaut löst es aus, wenn man sieht, wie die Presse (in dem Beitrag z.B. die ach so seriöse Apotheken-Umschau, aber auch die Vogue und andere Verlage/Magazine) gerne Geld entgegen nimmt, um dann positiv über gewisse Mittel zu berichten etc. (Ein Grund mehr, diese ganze Verdummungspresse, die einem da so am Zeitschriftenstand entgegengrinst, links liegen zu lassen.) Soviel zur „freien Marktwirtschaft”… Schaut Euch diese Sendung mal an, sie steht stand kostenlos in der ZDF-Mediathek zur Verfügung und zum Glück immer noch bei YouTube.
Auf ein paar inhaltliche Schwächen in dieser Dokumentation geht der Blog „Stationäre Aufnahme” näher ein.
Verwandte Beiträge:
 Dieser Hinweis in eigener Sache sei gestattet – ich bin doch sehr erfreut darüber, dass immerhin gut 50% der Leser mit Firefox (in seinen verschiedenen Varianten) unterwegs sind, weitere jeweils 6% mit Opera und Safari, während der virulente Internet Explorer mit ca. 35% doch erstaunlich dürftig abschneidet – das sah vor einigen Jahren noch ganz anders aus, die Microsoft-Dominanz scheint hier endgültig gebrochen zu sein. Warum überhaupt noch jemand den IE benutzt (abgesehen von den Menschen, die von ihrer Firma dazu verdonnert werden; sowas gibt’s tatsächlich, bspw. bei Siemens), ist mir ohnehin nicht ergründlich…
Dieser Hinweis in eigener Sache sei gestattet – ich bin doch sehr erfreut darüber, dass immerhin gut 50% der Leser mit Firefox (in seinen verschiedenen Varianten) unterwegs sind, weitere jeweils 6% mit Opera und Safari, während der virulente Internet Explorer mit ca. 35% doch erstaunlich dürftig abschneidet – das sah vor einigen Jahren noch ganz anders aus, die Microsoft-Dominanz scheint hier endgültig gebrochen zu sein. Warum überhaupt noch jemand den IE benutzt (abgesehen von den Menschen, die von ihrer Firma dazu verdonnert werden; sowas gibt’s tatsächlich, bspw. bei Siemens), ist mir ohnehin nicht ergründlich…
Verwandte Beiträge:
[Dieser Artikel stammt wieder von meinem geschätzten Gastautoren D. Anger.]
 Am 8. Dezember dieses Jahres verwies Peter auf einen sehr guten Film über die Produktion vieler bewusst kurzlebiger Verbrauchsgüter, namens The Story of Stuff. Darin taucht ein interessanter Gedanke auf: Je mehr ein Mensch konsumiert, desto unzufriedener wird er. Das Phänomen bezeichnen US-amerikanische Forscher als „The Consumer Paradox”, hierzu gibt es bereits verschiedene Studien, beispielsweise die Kollaboration der US-Universitäten von Illinois und Minnesota. Auch der britische Professor Richard Layard von der London School of Economics befasst sich bereits seit einiger Zeit mit diesem Thema.
Am 8. Dezember dieses Jahres verwies Peter auf einen sehr guten Film über die Produktion vieler bewusst kurzlebiger Verbrauchsgüter, namens The Story of Stuff. Darin taucht ein interessanter Gedanke auf: Je mehr ein Mensch konsumiert, desto unzufriedener wird er. Das Phänomen bezeichnen US-amerikanische Forscher als „The Consumer Paradox”, hierzu gibt es bereits verschiedene Studien, beispielsweise die Kollaboration der US-Universitäten von Illinois und Minnesota. Auch der britische Professor Richard Layard von der London School of Economics befasst sich bereits seit einiger Zeit mit diesem Thema.
Bei diesen Studien fanden die Forscher heraus, dass ein Hang zum Materiellen nicht nur mit einem schwach ausgeprägten Selbstwertgefühl korreliert, sondern sogar ursächlich für die geringe Eigenwertschätzung sein kann. Als Gegensatz konnte beobachtet werden, dass das Selbstwertgefühl einer Person steigt, wenn sie sich weniger von Materiellem abhängig macht.
Dies ist ein Paradoxon auf zweierlei Weise:
- Zum einen denken sehr viele Verbraucher, dass es ihnen besser ginge, wenn sie nur ein bisschen mehr verdienten. Schließlich könnten sie sich dann den teuren Fernseher, den schicken Anzug, den neuen Computer, die Schönheitsoperation oder etwas Ähnliches leisten. Der Kauf soll dann die harte Arbeit entlohnen; man hat sich dieses oder jenes „verdient”.
Ein „bisschen mehr verdienen” geht aber in der Regel mit längerer Arbeitsdauer und höherer Verantwortung einher. Beides sind Faktoren, die für viele Menschen belastend wirken, wenn sie über eine längere Zeit diesen Faktoren ausgesetzt sind. Somit sinkt ihre Zufriedenheit, obwohl sie durch Geld und Einkäufe doch angeblich steigen sollte. - Zum anderen gilt das „Ankurbeln der Binnenkonjunktur” als Allheilmittel in konjunkturell schwierigen Zeiten. Wenn Einnahmen von Staat und Wirtschaft sinken, weil die Menschen ihr Geld lieber sparen, anstatt es auszugeben, machen sich eine Reihe angeblich kluger Köpfe auf und entwickeln Maßnahmen, die die Menschen zum Konsum bewegen sollen.
Über „Konsumgutscheine” wird ebenfalls nachgedacht, obwohl diese Maßnahme sehr umstritten ist, da das der Allgemeinheit zur Verfügung gestellte Geld ohnehin vom Steuerzahler stammt und schließlich auch von diesem wieder eingeholt werden muss.
Auch wenn die erdachten Maßnahmen zum gewünschten Ergebnis führen, ist der dafür gezahlte Preis höher, als es die Statistik am Ende zeigt. Die Zufriedenheit weiter Teile der Gesellschaft nimmt weiter ab, mit den möglichen Konsequenzen von beispielsweise mehr Depressionen und mehr Suchtkranken. Die Umwelt wird stärker belastet, weil beim Anstieg der Verkäufe auch mehr schädliche Produkte erworben werden. Die Belastung der Umwelt führt ebenfalls zu einer steigenden Unzufriedenheit innerhalb der Gesellschaft. Die Ausbeutung billiger und stets verfügbarer Arbeitskräfte in Ostasien geht ungehindert weiter und nimmt womöglich zu. Der eigene Energieverbrauch erhöht sich, so dass auch diese Kosten ungeplant anwachsen.
So gilt es also – ganz egoistisch – der eigenen Zufriedenheit wegen, auf kurzfristigen Konsum zu verzichten. Der Besuch bei guten Freunden tut der eigenen Seele auch viel besser als ein neuer Fernseher. Und auch das eine oder andere Geschenk zur Weihnachtszeit darf gerne ein Taschenbuch und kein elektronisches Spielzeug sein. Es gilt, aus der Spirale der immer teureren und bunteren Geschenke auszubrechen und zu ein wenig Ruhe zu finden.
Diverse Quellen beschreiben, dass die Menschen vor 50 Jahren weniger Besitz als heute hatten, aber deutlich zufriedener waren. Man darf jedoch „weniger Besitz” nicht mit existenzbedrohender Armut oder dem Zustand eines kriegsversehrten Landes verwechseln. Es geht eher darum, das eigene Leben so zu vereinfachen, damit die wirklichen Freuden Zeit und Raum erhalten.
D. Anger
Verwandte Beiträge:
 Gibt es tatsächlich Menschen, die glauben, das Trinken von Cola light bzw. der neuen Sorte mit grünem Tee (was ja sicherlich eine Nähe zur sog. „Wellness“ suggerieren soll) wäre in irgend einer Form gesund? Gesünder (= weniger schädlich) als die normale Cola zumindest? Ich hoffe nicht, auch wenn der Coca Cola-Konzern in seiner Werbung natürlich genau diesen Eindruck zu erzeugen versucht – ich denke da nur an die Firmenmaxime, einen Lifestyle um dieses Getränk herum zu stricken:
Gibt es tatsächlich Menschen, die glauben, das Trinken von Cola light bzw. der neuen Sorte mit grünem Tee (was ja sicherlich eine Nähe zur sog. „Wellness“ suggerieren soll) wäre in irgend einer Form gesund? Gesünder (= weniger schädlich) als die normale Cola zumindest? Ich hoffe nicht, auch wenn der Coca Cola-Konzern in seiner Werbung natürlich genau diesen Eindruck zu erzeugen versucht – ich denke da nur an die Firmenmaxime, einen Lifestyle um dieses Getränk herum zu stricken:
Mit der aktuellen Kampagne “hello you” motiviert Coca-Cola light alle Frauen, ihre einzigartige Persönlichkeit noch mehr auszuleben.
Unglaublich dämlich, dieses plumpe Ansinnen der Marketingabteilung, aus einer braunen Blubberbrause sowas wie einen Persönlichkeitsverstärker zu machen. Nun ja, vermutlich fallen trotzdem ein paar Leute darauf hinein.
Gerne wird ja auch darauf verwiesen, dass dieses Getränk „null Gramm Zucker” enthielte. Das stimmt zwar, aber nur, wenn man unter Zucker den normalen Industriezucker versteht, denn selbstverständlich sind in der Cola light dafür ganz andere Elemente aus dem Chemiebaukasten vertreten. Ich zitiere den Greenpeace-Magazin-Artikel „Diät Cola – Was die Werbung verschweigt”:
Ist Cola Light ein Cocktail aus womöglich neurotoxischen und krebserregenden Substanzen? Davor warnt das britische Umweltmagazin „The Ecologist“. Als gefährlich prangert das Magazin den als krebserregend geltenden Süßstoff Aspartam an, aber auch zahn- und knochenschädigende Phosphor- und Zitronensäuren sowie erbgutschädigende Farbstoffe wie die Ammonsulfit-Zuckerkulör (E150d).
Wohl bekomm’s! Ich bleib dann doch lieber bei Wasser und Tee oder vielleicht mal einem Glas Wein oder einer Club Mate…
