Weil es so perfekt in meinem Blog passt (z.B. zu meiner Serie „Werbung schadet“), möchte ich den neuesten Paukenschlag von Egon W. Kreutzer hier (mit freundlicher Genehmigung) in Gänze veröffentlichen – der Artikel ist nicht immer ganz unpolemisch, spiegelt aber (deswegen?) sehr gut auch meine Meinung wider!
Werbung ist Krieg
Eine Frau,
vielleicht Mitte 30, versucht seit Jahren, immer in der Erkältungszeit, vor fast jeder Nachrichtensendung im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, uns weiszumachen, sie habe sich infiziert: “Spätestens Morgen hat es mich dann voll erwischt!”, sagt sie mit krächzender Stimme – und ist doch wunderbarerweise am nächsten Tag immer noch nicht krank – sie fühlt sich nur weiterhin und unermüdlich, Tag für Tag “Voll erwischt.”
Ein quietschfideler Herr
im prostatarelevanten Alter träumt nur noch davon, nachts weniger müssen zu müssen – doch dann, oh Schreck, platzt bei ihm die Blase. Tagtäglich. Ekelhaft, auch wenn es nur eine Spruchblase ist.
Ein Schwiegervater in spe
hält den Fahrer eines großen Autos, das die Umwelt nach Herstellerangaben um einen Deut weniger belastet als die anderen ganz großen Autos, für einen Hippie, dem er seine Tochter unter keinen Umständen anvertrauen möchte.
Eine Bank quatscht uns nimmermüde zu, mit ihrem Slogan von der Leistung aus Leidenschaft, und verspricht dem umworbenen Anleger sagenhafte 2,5 % Sparzinsen, ohne auch nur mit einer Silbe zu erwähnen, dass höhere Sparzinsen nur deshalb nicht gezahlt werden können, weil diese das Renditeziel der Eigentümer der Bank, nämlich eine Kapitalrendite von 25 Prozent jährlich zu erreichen, gefährden würden.
Käse
mit besonders runden Ecken und besonders aromatischer Käse sowie besonders leichter Käse und besonders besonderer Käse wetteifern mit allerlei natürlichen und artifiziellen Brotaufstrichprodukten aller Art um unsere Gunst.
Teewürste,
Kräuterliköre und eingelegte Gurken, alles nach uralten Geheimrezepten, und Gefriertorten, von denen – nicht zu Unrecht – die Sage geht, keine schmecke so wie diese, wollen gekauft und verzehrt werden.
Zahncremes,
wohlschmeckende wie antibakterielle, antiplaquetuelle und antiverfärbuelle, dazu unlösbar haftende Haftcremes, unendlich zarte Handcremes, extrem faltenglättende Tag- und Nachtcremes, versprechen gesunde Schönheit und schönste Gesundheit.
Papiere von der Rolle,
reiß- und ribbelfest, wunderweich-sanft, holzfrei und chlorfrei gebleicht, verwöhnen die zarteste Haut ebenso wie 6-fach-federnd gelagerte, tiefergelegte und hinter Gittern eingesperrte Rasierklingen.
Spül- und Waschmaschinenchemie
als Tabs, als Perls und als Liquids, für die rückstandsfrei radikale und zugleich absolut schonende, ja sogar Farbe, Form und Glanz regenerierende Schmutz- und Fleckentfernung bei allen Temperaturen zwischen 15 und 95 Grad Celsius, versprechen – gender-mainstreamend – sowohl höchstes Hausmanns- als auch höchstes Hausmänninnen-Glück.
Im Briefkasten
vermehren sich die Wurfsendungen der ortsansässigen Filialen aller großen Handelsketten wie von selbst, dazwischen finden sich die Hochglanzprospekte der billigsten Optiker aller Zeiten und der schärfsten Sexshops zwischen Hildesheim und Wanne-Eickel, obendrauf, füllig und jede Woche dreimal neu, die aktuellen Sonderangebote der drei oder vier großen Supermärkte im Umkreis von 15 Kilometern – und irgendwo zwischendrin der immer wieder originelle Flyer des Pizza-Homeservices mit dem Knüller der Woche: Zur 128×96 cm Mega-Leichenschmauspizza gibt es diesmal – so lange der Vorrat reicht – eine 3-Liter- Flasche Lambrusco Landwein, garantiert europäischen Ursprungs, gratis.
Im World Wide Web
unterwegs, zwischen blinkenden, aufpoppenden, plötzlich aus den Lautsprechern losdröhnenden, der Maus impertinent ausweichenden Werbebotschaften, und zu versuchen, dennoch zum eigentlichen Ziel zu navigieren, ist eine hohe Kunst. Wer sie nicht beherrscht, wird sich immer wieder aufs Neue im Nirwana der Internetwerbung verlieren.
Werbung ist überall.
Im Fernsehen, im Rundfunk, in den Tageszeitungen, auf Plakatwänden und Litfaßsäulen, sie kriecht aus den Werbebildschirmen an den Bahnhöfen, springt uns von den Werbebildschirmen in den Wartezimmern der Arztpraxen ebenso an, wie von den als Bande benutzten Werbebildschirmen in den Stadien – und wenn gerade Saison ist, wuchern an allen Straßenecken die Plakatständer der Parteien und lassen die daraufgeklebten Kandidaten hoffnungsfroh ins Volk grinsen.
Die allermeiste Werbung ist dabei einfach nur doof, zielt mit dem Holzhammer auf archaische Triebe und niedere Instinkte, versucht die Eitelkeit des Kunden auszunutzen und wird, damit sie auch ankommt, bis zum Erbrechen
wiederholt.
Ein kleiner Teil der Werbung bemüht sich, den potentiellen Käufer mit Humor zu überlisten. Ein winziger Teil appelliert sogar an die Intelligenz der Zielgruppe, beziehungsweise an das, was die Kreativen in den Agenturen und ihre Auftraggeber dafür halten.
Werbung, die wahre und vollständige Informationen über das beworbene Produkt transportiert, die neben seinen Vorteilen auch die Nachteile anspricht, die nicht nur den attraktiv erscheinenden Preis, sondern auch die Betriebs- und Folgekosten nennt und einem potentiellen Kunden
auch einmal vom Kauf abrät, wenn das Produkt nicht für ihn passt, ist so selten, dass mir lange keine mehr unter die Augen gekommen ist.
Fakt ist, dass auch noch die fieseste und blödeste Werbung, die man uns zumutet, funktioniert.
Warum das so ist, hat Vance Packard schon 1957 in seinem vielbeachteten Buch “Die geheimen Verführer – der Griff nach dem Unbewussten in jedermann” beschrieben. An den wesentlichen Prinzipien, mit deren Hilfe die Werbung den Verstand der Konsumenten ausschaltet oder austrickst, hat sich seitdem nichts geändert.
Der gravierende Unterschied zu 1957 ist, dass heute die Reaktionen der Kunden sehr viel schneller, sehr viel besser und präziser erfasst und ausgewertet werden können, als das damals der Fall war, was eine schnelle und gezielte Optimierung der Marketingstrategie und der Werbemaßnahmen ermöglicht.
- Plakatwände hinter denen Kameras montiert sind, die die Gesichtszüge der Passanten beim Wahrnehmen der Werbung aufnehmen und ihre Bilder an Computer senden, die diese Reaktionen auswerten,
- Kundenkarten jeder Art, die dem Einzelhandel verraten, wer sich regelmäßig mit welchem Mix aus Joghurt, Müsli, Frischgemüse und Präservativen oder aus Fertigmenüs, Pralinen, Cognac und Erotikmagazinen versorgt, und wie sich das Einkaufsverhalten der Karteninhaber infolge neuer Werbebotschaften verändert – oder nicht,
- Cookies und Consorten, die jeden Internetuser begleiten, seine Suchanfragen protokollieren, seine Interessen erforschen, seine Einkäufe im Netz protokollieren und festhalten, auf welche Reize er anspricht,
- Raffinierte Instrumente zur Erfolgsmessung von Werbebotschaften in Testmärkten,
- usw.
- usw.
alles das ermöglicht heute eine Feinsteuerung der Werbemittel, die jedem, der sich dieser Mittel und Methoden bewusst ist, gespenstisch erscheinen muss – denn der Versuch, der allgegenwärtigen Werbung zu entkommen, ist – will man nicht auf eigene Kosten zum Eremiten umschulen – aussichtslos.
Doch die Erscheinungsformen der Werbung, denen wir tagtäglich unentrinnbar ausgesetzt sind, sind nur die Spitze des Eisbergs, die Blüten der Verlockung. Sie lassen von dem Dschungelkrieg hinter den Kulissen, von dem unerbittlichen Zwang zu immer mehr Werbung, dem fast alle Unternehmen unterliegen, nichts ahnen.
Werbung ist Krieg.
Die Sieger in diesem Krieg gehen als Marktführer vom Schlachtfeld und verdienen sich ab dann dumm und dämlich.
Die Verlierer gehen in Insolvenzen und Übernahmen, in Geschäftsaufgaben und Totalausverkäufen unter.
Die Größenordnungen
Rund 30 Milliarden Euro fließen in Deutschland jährlich in die Werbewirtschaft. Das scheint, gemessen am BIP nicht viel, gerade einmal 1,25 Prozent. Kann dieses bisschen Geld tatsächlich zur kriegsentscheidenden Größe werden?
Oh ja. Doch zunächst einmal gilt es, die wahren Relationen aufzuzeigen.
Mit den 30 Milliarden, die in Deutschland jährlich von der Werbewirtschaft verbraten werden, zielen die Wirtschaftsunternehmen nicht auf die volkswirtschaftliche Gesamtleistung, sondern fast ausschließlich auf jenen Teil, der den Konsumenten davon als Kaufkraft zur Verfügung steht. Das ist weit weniger.
Die Arbeitnehmerentgelte, einschließlich der Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung machen brutto gerade einmal die Hälfte des BIP aus. Wenn Steuern und Sozialversicherungsbeiträge sowie die zurückfließenden Transferleistungen aus dem Steuersäckel und aus den Sozialkassen berücksichtigt werden, bleiben davon als freie Kaufkraft der Konsumenten noch etwa 800 Milliarden zur Verfügung.
Feststehende Ausgaben, wie Miete und Nebenkosten, Zins und Tilgung, langfristig laufende Versicherungsverträge mindern das per Werbung erreichbare Nachfragevolumen weiter, während es durch die Vergabe neuer Kredite erweitert wird.
Ich gehe in meinen Abschätzungen davon aus, dass sich die Gesamtaufwendungen der Werbewirtschaft in Deutschland auf ein Kaufkraftvolumen von rund 600 Milliarden Euro jährlich beziehen. Mag sein, dass es 50 oder 100 Milliarden mehr oder weniger sind – das ist gar nicht entscheidend. Entscheidend ist, dass das Volumen der Massenkaufkraft von nur zwei Faktoren abhängt, nämlich von den Lohnabschlüssen und vom Kreditgebaren der Banken, und durch Werbung allenfalls marginal beeinflusst werden kann.
Werbung kann folglich – mangels Einfluss auf die verfügbare Kaufkraft – kein Wirtschaftswachstum hervorbringen.
Die Theorie, Werbung alleine könne Mehr-Umsätze generieren, die zu Wirtschaftswachstum führen, ist irrig.
Werbung zielt einzig darauf ab, den Umsatz des werbenden Unternehmens und damit seinen Marktanteil zu Lasten der Konkurrenten zu erhöhen oder zumindest zu halten. Die betriebswirtschaftliche Begründung dafür ist vielschichtig. Ein wesentlicher Ansatzpunkt findet sich in der sogenannten Fixkostendegression. Das klingt kompliziert, und ist eigentlich ganz einfach.
Fixkosten sind jene Kosten, die unabhängig vom Umfang der Produktion bzw. des Umsatzes in unveränderter Höhe dauerhaft anfallen. Das Gegenteil sind die variablen Kosten, die jedem einzelnen erzeugten Produkt, hauptsächlich in Form von Material- und Lohnkosten, direkt zugerechnet werden können.
Die verheerende Wirkung der Werbung auf den Markt.
Dargestellt an einem fiktiven Beispiel:
Hat ein Unternehmen einen Investitionskredit von 5 Millionen Euro aufgenommen und muss dafür jährlich 300.000 Euro Zinsen zahlen, dann handelt sich bei den Zinsen um Fixkosten. Auch die Abschreibung für die Investitionen, die 10 Jahre lang jährlich 500.000 Euro ausmacht, gehört zu den Fixkosten, die vollkommen unabhängig davon anfallen, wie viel produziert und verkauft wird.
|
Da schlägt er eines Tages, es ist Ende Oktober, seine Lieblings-Illustrierte auf. Und was springt ihm ins Gesicht? Eine ganzseitige Farbannonce der fernöstlichen Konkurrenz, mit der die neuen, modischen Modelle der Herbst- und Winterkollektion angepriesen werden.
|
Die Agentur entwickelt ein Konzept – und stellt dafür 60.000 Euro in Rechnung. Für die Realisierung der Kampagne, die über vier Wochen lang, von Mitte Oktober bis Mitte November mit vielen intelligenten, viertelseitigen Farb- und Schwarz-Weiß-Anzeigen in ausgewählten Printmedien laufen soll, werden rund 340.000 Euro veranschlagt.
|
Aber lassen wir unseren Schirmfabrikanten mit Hilfe seiner Werbeagentur die Schlacht dieses Herbstes gewinnen.
|
Der Zwang zum Weiterwerben und weitere Zwangsläufigkeiten
|
Werbung ist Krieg.
Den Konsumenten fällt dabei die Rolle von Bomben, Minen und Sprengfallen zu, und die Werbung liefert die Zünder, mit denen diese Sprengsätze zur Explosion gebracht werden.
Die Konsumenten, denen man einredet, blöd zu sein, wenn sie nicht den Sirenengesängen der Werbung folgen, sind natürlich auch dann nicht blöd, wenn sie ihnen folgen. Sie sind nur kurzsichtig.
Und so zerstören sie in ihrer Kurzsichtigkeit, mit dem guten Gefühl, eine gute, preiswerte Wahl getroffen zu haben, den Markt, die Vielfalt und den Wettbewerb.
Erst sind die Tante-Emma-Läden gestorben, dann die kleinen, kompetenten Fachhändler, jetzt kracht es bei den Großen. Baumärkte und Möbelhäuser, Drogeriemarkt- und Buchhandelsketten, Lebensmittelgroßverteiler, Schuh-Discounter, altmodische Kaufhäuser und Versandhändler sind angetreten, um die letzte große Schlacht um den Markt Europa auszutragen – im realen und im virtuellen Laden.
Von den Werbekampagnen der schon übergroßen Anbieter willenlos getrieben, wählen die Kunden – wie die dümmsten Kälber den Metzger – ihren künftigen Monopolisten selber.
Machen Sie endlich die Augen auf!
Großer Werbeaufwand ist kein Qualitätsmerkmal!
Schauspieler, die in Werbefilmen beglückt die Augen verdrehen, wenn sie sich das beworbene Produkt in die Haare schmieren, werden für diese Rolle engagiert und bezahlt. Die nehmen das nicht selbst!
Sportler, die sich vor den Karren der Werbung spannen lassen, haben womöglich ihr ganzes Leben lang hart trainiert, um auf dem Umweg über die Goldmedaille zum bestbezahlten Werbeschauspieler mutieren zu dürfen.
Gute, nützliche und preiswerte Produkte verkaufen sich von selbst, solange sie nicht mit Hilfe aggressiver Werbung von schlechten, unnützen und überteuerten Produkten verdrängt werden, von Produkten die sich ohne massive Werbung gar nicht verkaufen ließen.
Versuchen Sie doch einfach einmal,
beim nächsten Einkauf nur solche Produkte in den Wagen zu legen, die Ihnen noch nie in der Werbung begegnet sind.
Und dann schreiben Sie einen Erfahrungsbericht über die Produkte, die Sie neu für sich entdeckt haben – beleben Sie die Mund-zu-Mund-Propaganda im Internet.
Es war einmal eine Vertreterversammlung einberufen worden.
Der Vertriebsvorstand und seine Außendienstler mussten sich vom Vorstandsvorsitzenden der Gesellschaft übel beschimpfen lassen, weil sie die Verkaufsziele weit verfehlt hatten.
Da fingen die Vertreter an zu klagen:
- Wenn wir gute Produkte hätten, die einen klaren Vorteil gegenüber der Konkurrenz bieten,
- wenn wir Produkte hätten, deren Qualität anerkannt und durch Garantien abgesichert ist, oder
- wenn wir wenigstens Produkte hätten, die nur so gut sind, wie die der Konkurrenz, aber entschieden billiger –
dann könnten wir die Verkaufsziele erfüllen.
Da erhob sich der Vorstandvorsitzende, trat ans Rednerpult und sprach:
Sie sollten dankbar sein, dass Sie die Gelegenheit haben, genau die Produkte zu verkaufen, die wir im Angebot haben.
Hätten wir die Produkte im Angebot, die Sie sich wünschen, meine Herren, dann bräuchte ich Sie nämlich nicht.


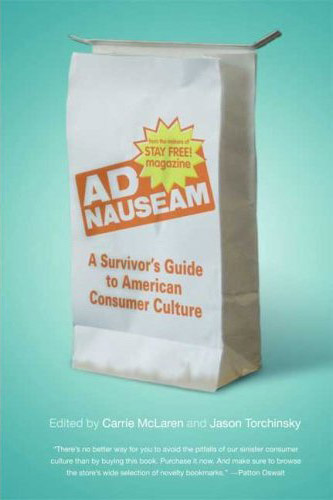
 Die Wirklichkeit sieht natürlich anders aus, als sich das die Herren & Damen in den Werbeagenturen so vorstellen. Reklame wird doch von der Mehrzahl der Menschen als sehr störend, als Belästigung empfunden. Dies erkennt man z.B. daran, dass neue Festplattenrecorder gleich mit einer Funktion zum automatischen Wegschneiden von Werbeblöcken versehen sind. Dass Fernsehreklamespots lauter sind als der eigentliche Film, weil die Werbetreibenden wissen, dass die meisten Zuschauer auf Toilette oder in die Küche gehen, wenn der Konsumterror beginnt. Und von meinen Streifzügen mit Flugzettelverteilen weiß ich, dass viele Bürger sich den Einwurf von Reklamegedöns mit mehr oder minder deutlichen Aufklebern an ihren Briefkästen verbitten (nicht alle so direkt wie ein Anwohner in Hamburg: „Keine Scheiß Reklame!”). Natürlich kann Werbung auch nützlich sein, vor allem im kleineren Rahmen, doch auf die großen Image- & Markenkampagnen in Funk & Fernsehen trifft dies sicherlich nicht zu.
Die Wirklichkeit sieht natürlich anders aus, als sich das die Herren & Damen in den Werbeagenturen so vorstellen. Reklame wird doch von der Mehrzahl der Menschen als sehr störend, als Belästigung empfunden. Dies erkennt man z.B. daran, dass neue Festplattenrecorder gleich mit einer Funktion zum automatischen Wegschneiden von Werbeblöcken versehen sind. Dass Fernsehreklamespots lauter sind als der eigentliche Film, weil die Werbetreibenden wissen, dass die meisten Zuschauer auf Toilette oder in die Küche gehen, wenn der Konsumterror beginnt. Und von meinen Streifzügen mit Flugzettelverteilen weiß ich, dass viele Bürger sich den Einwurf von Reklamegedöns mit mehr oder minder deutlichen Aufklebern an ihren Briefkästen verbitten (nicht alle so direkt wie ein Anwohner in Hamburg: „Keine Scheiß Reklame!”). Natürlich kann Werbung auch nützlich sein, vor allem im kleineren Rahmen, doch auf die großen Image- & Markenkampagnen in Funk & Fernsehen trifft dies sicherlich nicht zu. Davon, dass viele Werbesprüche eine unzulässige Verkürzung der Realität darstellen und oft genug eben NICHT den wahren Unternehmensabsichten entsprechen, sondern eher kaschieren, will ich hier gar nicht reden. Sondern nur noch kurz darauf hinweisen, dass die Reklamesprache eine schleichende Entwertung von so manchem Begriff vorantreibt (siehe
Davon, dass viele Werbesprüche eine unzulässige Verkürzung der Realität darstellen und oft genug eben NICHT den wahren Unternehmensabsichten entsprechen, sondern eher kaschieren, will ich hier gar nicht reden. Sondern nur noch kurz darauf hinweisen, dass die Reklamesprache eine schleichende Entwertung von so manchem Begriff vorantreibt (siehe